
Die Newtonschen und Fresnelschen Beugungsexperimente
Die Weiterführung der Newtonschen Beugungsexperimente
Beugung von Licht an Spalt und Hindernis
Interferenz-Winkelbedingung, Beugung und
Abbildung
Beugungen hintereinander folgend und mit
Zwischenabbildung
Frequenzminderung nach der Beugung
Innere und äußere Beugungsstreifen von
Kreisöffnungen
Überlagerung von Interferenz und Beugung
Beugungsexperimente mit inhomogener
Beleuchtung
Experimente mit polarisiertem Licht mit
Spalt und Doppelspalt
Der Untergrund von Beugungsfiguren
Versuch der Deutung der Newtonschen
Beugungsexperimente
Folgerungen aus den Newtonschen
Beugungsexperimenten für Photonen
Folgerungen für die Struktur des
Elektrons aus der des Photons
Das thermisch bedingte elektromagnetische
Feld
Beugung und Lichtemission von
Elektronen
Energiestufen der Elektronen im
magnetischen Eigenfeld
Faradays elektro-tonische Zustände
Nahfeldoptik mit Berücksichtigung der
Newtonschen Beugungsexperimente
Die Berücksichtigung der magnetischen
Momente in der Quantentheorie
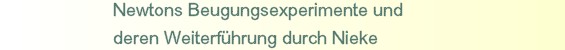
Folgerungen aus den Newtonschen Beugungsexperimenten für Photonen
Mit dem Nachweis der Lokalisierung des gebeugten Lichtes in der engen Umgebung der Kante in Abhängigkeit vom Beobachtungswinkel durch Newton war bereits gezeigt, daß die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation für die Beugung am Spalt nicht anwendbar sein kann. Aus Newtons Beugungsexperimenten und deren Weiterführung wurde die Struktur des Photons als elektromagnetisches Wirbelpaar gefolgert. Für Photonen mit dieser Struktur wird das Einstein-Podolsky-Rosen Paradoxon gegenstandslos. Es wird diskutiert: Spontane-, Sammel-, Hertzsche Dipol- und Stimulierte-Emission. Die Lebensdauer oder Verweilzeit wird als Zeit für den Aufbau des Photons mit Struktur gedeutet.
.....
Das Feld des Photons
Nieke [3] und [4] bestätigte, daß Newton mit seiner Behauptung: 'Niemals kann Licht eine Welle sein' recht hatte, denn das hatte er mit dem Übergang innerer zu äußeren Beugungsstreifen am Spalt und der Lokalisierung gebeugten Lichtes bewiesen. Nach Nieke [5] haben die Photonen mit Struktur ein elektromagnetisches Feld, wobei das Feld ein Teil des Photons ist. Diese Feld wird mit dem Photoeffekt nachgewiesen, aber dieses Feld zeigt auch Wirkungen auf sein Photo mit Richtungsänderungen. Die Wirkung des Feldes wurde früher als Welleneigenschaft bezeichnet. Dies ist also auch ein Beitrag zu Genz [27], der den leeren Raum betrachtete.
Literatur
[1] I. Newton, Opticks or a Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light. London 1704; Opera que exstant omnis, Tom IV, London 1782; Optics. Reprint, Bruxelles 1966; Optik II + III, Übers. W, Abendroth, Ostwald's Klassiker Nr. 97, Engelmann, Leipzig 1898; Neuauf1age, Nr. 96/97, Vieweg, Braunschweig 1983; Optique, trad. J. P. Marat 1787; Reproduction, Bourgois, Paris 1989.
[2] A. J. Fresne1, Oeuvre Complétes I. Paris 1866; Abhandlungen über die Beugung Lichtes. Ostwalds K1assiker Nr. 215 Engelmann, Leipzig 1926.
[3] H. Nieke, Newtons Beugungsexperimente und ihre Weiterführung. Arbeit 1.
[4] Wie [3], Arbeit 2.
[5] Wie [3], Arbeit 12.
[6] A. Sommerfeld, VorIesungen über theoretische Physik, Bd. II Mechanik der deformierbaren Medien. Akad. Verlagsges., Leipzig 1945, S. 155.
[7] W. Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie. 2.Aufl. Hi.rzel; Leipzig 1941; The Physical Principles of Quantum Theory. University Press Chigago 1930.
[8] E. Schrödinger, Über den Indeterminismus in der Physik. Barth, Leipzig 1932, S. 9.
[9] O. Carnal u. J. Mlynek, Phys. Bl. 47 (1991) 379.
[10] A. Einstein, B. Podolsky a. N. Rosen, Phys. Rev. 47 (1935) 777.
[11] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony a. R. A. Holt, Phys. Rev. 23 (1969) 880.
[12] M. Planck, Wärmestrahlung. 5. Aufl. Barth, Leipzig 1923.
[13] In: Pauli, (Ed~), Niels Bohr - and the development of physics. Pergamon, London 1955, p. 14.
[14] H. Georgi, Sci. Am (USA) 244 (1981) Nr. 4, p. 40; Spectrum d. Wiss. (1981) Juni, S. 70.
[15] I. C. Slater, Nature 113 (1924) 307.
[16] N. Bohr, A. W. Kramers a. I. C. Slater, Z. Phys. 24 (1924) 69; PhiI. Mag. 47 (1924) 785.
[17] L. D. Landau. E. M.Lifschitz, Lehrbuch der theoretischen~Physik, Bd II, Klassische Feldtheorie. Akademie Verlag, Berlin 1967, S. 199.
[18] W. E. Lamb jr. a.R. C. Retherford, Phys. Rev. 72 (1947) 241; 79 (1950) 549; 81 (1950) 222.
[19] R. W. James a. G. W. Brindley, Proc. Roy. Soc. London A 121 (1928) 155
[20] H. Hertz, Ann. Physik (III) 36 (1889) 1; Ges. Werke,Bd. II, Barth, Leipzig 1892, S. 147, Zitat S. 170.
[21] P. L. Kapitza a. P. A. M. Dirac, Proc. Cambridge Phil. Soc. 28 (1933) 297.
[22] H. Schwarz, Z.Phys.204 (1967) 276; Phys. Bl. 26 (1970) 436.
[23] P. Gould Am. J. Phys. 62 (1994) 1046.
[24] G. Mayar a.. L. MandeI, Nature 198 (1963) 255.
[25] G. Richter, W. Brunner u. H. Paul, Ann. Physik (7) 14 (1968) 239.
[26] G. Rempe, Phys. Bl. 51 (1995) 383.
[27] H. Genz, Naturwissenschaften 82 (1995) 170.
© 2006 by tediamedia • info@gebeugtes-licht.de